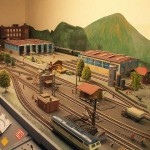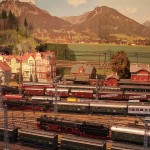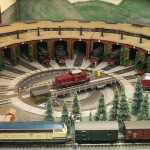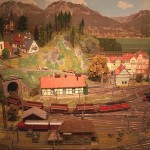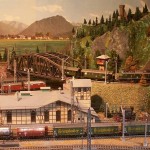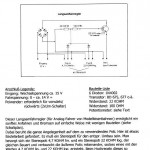von Udo Liessem
Weniger aufregend waren in der Zwischenzeit andere Ereignisse verlaufen: Am 15. Februar 1865 hatte man in Rübenach eine Postanstalt im Range einer Postexpedition 2. Klasse umgewandelt, das ab 1876 zu einer Postagentur zurückgestuft wurde. Den Postkutschenverkehr Koblenz.Mayen, den zuletzt der Mayener Posthalter Luxem wahrgenommen hatte, wurde 1904 bei Eröffnung der Reichsbahn eingestellt. Hervorzuheben ist der 1. Juli 1878, da an diesem Tag die Postanstalt einen Telegraphen bekam und somit war Rübenach an das bereits sehr bedeutende Telegraphennetz des Deutschen Reiches angeschlossen.
Bald nach der Reichsgründung hatte sich in Rübenach auch der sogenannte „ Kulturkampf“ vehement bemerkbar gemacht. Die Streitigkeiten mit der Regierung hatten sich an der rechtlich nicht einwandfreien Einsetzung des Kaplans Josef Reis in Rübenach entzündet und kulminierten in der zweifachen Inhaftierung das Geistlichen (1873 und 1874). 1875 wurde Reis sogar des Regierungssitzes verwiesen, 1876 der Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt und aus dem Reichsgebiet ausgewiesen! Erst 1884 wurde die Strafvollstreckung eingestellt. Siehe auch: Die Zeit des Kulturkampfes in Rübenach
Die Jahre 1900/01 dürfen besondere Aufmerksamkeit, was das Dorfgeschehen betrifft, für sich beanspruchen, da es Pastor Oden (1897-1905) gelungen war, eine Niederlassung der Dernbacher Schwestern nach Rübenach zu bekommen. Das Kultusministerium gab hierzu dem 6. März 1900 seine Erlaubnis. Am 28. Mai 1901 erfolgte die Eröffnung des Klosters, das 1904 eine Hauskapelle (Hl. Anna) bekam. Der Aufgabenbereich der Schwestern nach erstreckte sich auf Altenpflege, Kindergarten, Nähschule u. v. a. 1921 musste das Haus erweitert werden. Diese Arbeiten führte der Koblenzer Architekt Huch durch.
Huch hatte auch zusammen mit Grefges, ebenfalls Koblenz, 1908/09 die Bubenheimer Kirche, die ja Filiale von Rübenach ist, entworfen: Die Kirche ist ein sehr gefälliger Jugendstilbau, bei dem auch barocke Elemente zur Verwendung kamen. Bei Huch und Grefges handelt es sich um zwei sehr talentierte Architekten, die zu unrecht vergessen sind, deshalb folgt auch eine bescheidene Liste ihrer Bauten.
1905……..Waisenhaus in Koblenz / Huch und Grefges
1908/09 Kirche in Bubenheim / Huch und Grefges
1912/13 Erweiterung der Kirche in Kehlberg/Eifel / Huch
1914/15 Kirche in Metternich / Huch und Grefges
1921…….Erweiterung des Klosters in Rübenach / Huch
1922…….Kirche in Stromberg/Ww. / Huch
1933/34 Kirche in Kesselheim / Huch und Grefges
Wie bereits gesagt, waren die Vereine und Bruderschaften von höchster Wichtigkeit für die Dorfgeschichte, ihr Schwerpunkt lag voe allem im sozialen Bereich. Die Mauritiusbruderschaft und die des Allerheiligsten Sakramentes wurden schon erwähnt; ebenso die Schützenbruderschaft. Der Geist von 1848 – Rübenach war nicht besonders davon betroffen worden – lebte zunächst noch weiter in den Schützengesellschaften, was sich etwa bei den großen Schützenfesten manifestierte. Bei dem mittelrheinischen Schützenfest von 1851 in Koblenz war auch die Rübenacher Bruderschaft vertreten; ebenso 1852 beim hundertjährigen Jubiläumsfest in Ehrenbreitstein. Patriotismus bewies die Gesellschaft, als sie zum 90. Geburtstag Kaiser Wilhelms I., am 22. März 1887, zusammen mit dem Männergesangsverein die Kaiserlinde pflanzte (neben dem späteren Kriegerdenkmal). Ein Ereignis, an dem das ganze Dorf teilnahm und zu dem viele Brudervereine kamen, bildete die Fünfzigjahrfeier im Jahre 1893. Die 1896 gegründete Sterbekasse zahlte den Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitglieds 50 Mark. 1903 baute man eine gedeckte Halle auf dem Schützenplatz und einen neuen Schießstand.
Das größte Ansehen hatte wohl der 1854 gegründete Männerchor – ursprünglich „Cäcilia“ – genossen, der aber Vorläufer gehabt hatte; Chorsänger wurden schon 1705 genannt. Neben dem eigentlichen Zweck, der Pflege des Liedgutes, standen Geselligkeit und gegenseitige Hilfe weit im Vordergrund. „Im Jahre 1901 musste der Kirchen-Chor als solcher, seiner Satzungen nach dem Muster des Diözesan-Cäcilien-Verbandes umändern. Es fand gleichsam eine Trennung statt zwischen weltlich und kirchlich. Beide Teile behielten den Namen Cäcilia bei und auch noch dieselben Mitglieder. So hat keine eigentliche Neugründung stattgefunden.
Pastor Bläser (1826-1852) gründete eine Bruderschaft vom hl. Herzen Mariä; 1899 gab es bereits daneben einen Verein der hl. Familie, einen Mütter verein und eine Marianische Jungfrauen-kongregation. 1902 etablierte sich ein Jünglingsverein. Die Vereine waren alle irgendwie kirchlich gebunden, wenn sie nicht sogar direkt von ihr getragen waren. Eine hervorragende Leistung war die Einrichtung einer Pfarr-Lesebibliothek durch Pfarrer Caspar (1852-1866), der selber viele Bücher stiftete und aus der der Borromäusverein Rübenach hervorgegangen ist. Es ist nicht verwunderlich, aber nichts desto trotz sehr verdienstvoll, dass so früh in Rübenach eine solchartige Kultureinrichtung geschaffen worden war, denn 1845 hatte der Koblenzer August Reichensperger in Bonn den Borromäusverein gegründet (= Verein vom hl. Karl Borromäus zur Verbreitung guter Bücher).
An dieser Stelle muss noch kurz auf die beiden Volksmissionen von 1899 und 1912 verwiesen werden.
Nicht abschätzbar ist der Einfuss, den die Bahnstrecke Koblenz-Mayen, eröffnet 1904, auf die Entwicklung von Rübenach ausgemacht hat. Damit war das Dorf noch enger an die Stadt gebunden und es konnte vor allem seine landwirtschaftlichen Produkte, hier an erster Stelle die Kartoffel auf die Waggons verladen und schnell und billig überall hin verfrachten – doch muss in diesem Zusammenhang auch der Personenverkehr berücksichtigt werden. Das Stationsgebäude war ein gutproportionierter zwei-geschossiger Bau mit einstöckigem Nebengebäude, einem zierenden Ecktürmchen und einem großen Waldach. Es war ein hübscher und dabei sehr typischer Jugendstilbau (heute stark verändert und in dem seit den 80er Jahren des letzten Jahrhundert ein Gewerbebetrieb untergebracht ist Red.)
Ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung weist nicht nur das bloße Steigen der Einwohnerzahl nach, sondern legt auch das Wachsen um die Jahrhundertwende (Eröffnung der Bahn, Ansiedlung von außerhalb) klar dar:
1817…….790
1840…….1332
1871…….1495
1884…….1630
1897…….1884
1905…….2111
1914…….2206
1227…….2600 ca.
1935…….2707
Die Kriege von 1866 und 1870/71 und der Erste Weltkrieg 1914/18 forderten viele Tote. In den ersten beiden Kriegen fielen je zwei Rübenacher und im Weltkrieg 51. Ihnen wurde 1913 ein Denkmal gesetzt, das 1922 für die Toten des Weltkrieges vergrößert werden musste. Das Denkmal weist noch starke Jugendstileinflüsse auf (Inschrift: Gott mit uns – Rübenach seinen Helden).
Ein einzigartiges Zeitdokument, das in dieser Vollständigkeit im gesamten Großraum Koblenz nicht mehr auftritt, ist das Eckhaus „v. Eltz-Straße“ / „Gotenstraße“, datiert 1903 (Baumeister J. Mohrs). Das Gebäude, das bewusst Ziegelmauerwerk Putzflächen gegenüberstellt, weist hauptsächlich Elemente von zwei verschiedenen Stilrichtungen auf: Historizismus und Jugendstil. Das Haus ist bis in alle Einzelheiten (Verputz, Farbigkeit, Türen, Gitter, Kacheln, Firmenschild, Stuckdekorationen etc.) noch so, wie 1903 fertig gestellt worden war.
Ein weiterer wichtiger Bau im Ortsbild ist die ehemalige Gastwirtschaft Schwamm („Aachener Straße“ heute ein Elektrofachgeschäft Red.) mit ihrem Saal, wozu auch ehemals eine Kegelbahn gehörte. Das interessanteste am Bau aus 1906 ist der Giebel das Saalbaus mit vorgeblendetem Pseudo-fachwerk in reinstem Jugendstil (Hier wurde 1948 das erste ständige Kino eingerichtet).
Ein qualitätsvoller Rübenacher Profanbau ist auch das Wohnhaus „Aachener Straße“ 123. Diese Jugendstilvilla mit Fachwerkober-geschoss aus rot gestrichenem Holz über hell geputztem Mauerwerk ist datiert „Haus Hertling erbaut 1911“. Die Einzigartigkeit dieses Anwesens kommt erst voll nach einer gründlichen Restaurierung zum Tragen.
Zeichen der damaligen, gut gehenden Konjunktur bilden die zweistöckigen Backsteinhäuser in der „Kilianstraße“ 36 bis 56. Sie sind nach einheitlichem Plan gebaut, sind dreiachsig, haben kleine Nebengebäude und kleine Gärten. Die Häuser wurden um 1905 – 1910 von dem Bauunternehmer Bretz erbaut und für 300 Mark veräußert. Noch verschiedene andere Bauten aus der Zeit nach der Jahrhundertwende zeigen gute Qualität: „Alte Straße“ 3, Wohnhaus aus 1907 mit Jugendstilschmuck oder „Rosenbornstraße“ 2 und 4, zwei Bauten mit Fachwerkobergeschossen, ebenfalls aus 1907.
.
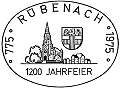 Quelle Buch Rübenach eine Heimatgeschichte
Quelle Buch Rübenach eine Heimatgeschichte
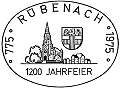 Quelle Buch Rübenach eine Heimatgeschichte
Quelle Buch Rübenach eine Heimatgeschichte


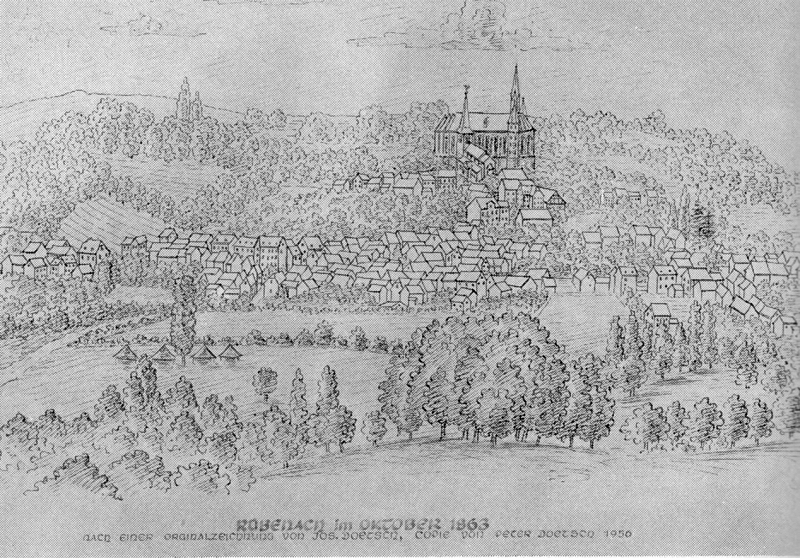


 Wilfried Mohr wohnt heute in Arenberg. Der ehemalige Rübenacher hat seine Verbundenheit mit unserem Ort jedoch nie verloren. Etliche Fotoaufnahmen von ihm über Rübenach sind unter
Wilfried Mohr wohnt heute in Arenberg. Der ehemalige Rübenacher hat seine Verbundenheit mit unserem Ort jedoch nie verloren. Etliche Fotoaufnahmen von ihm über Rübenach sind unter